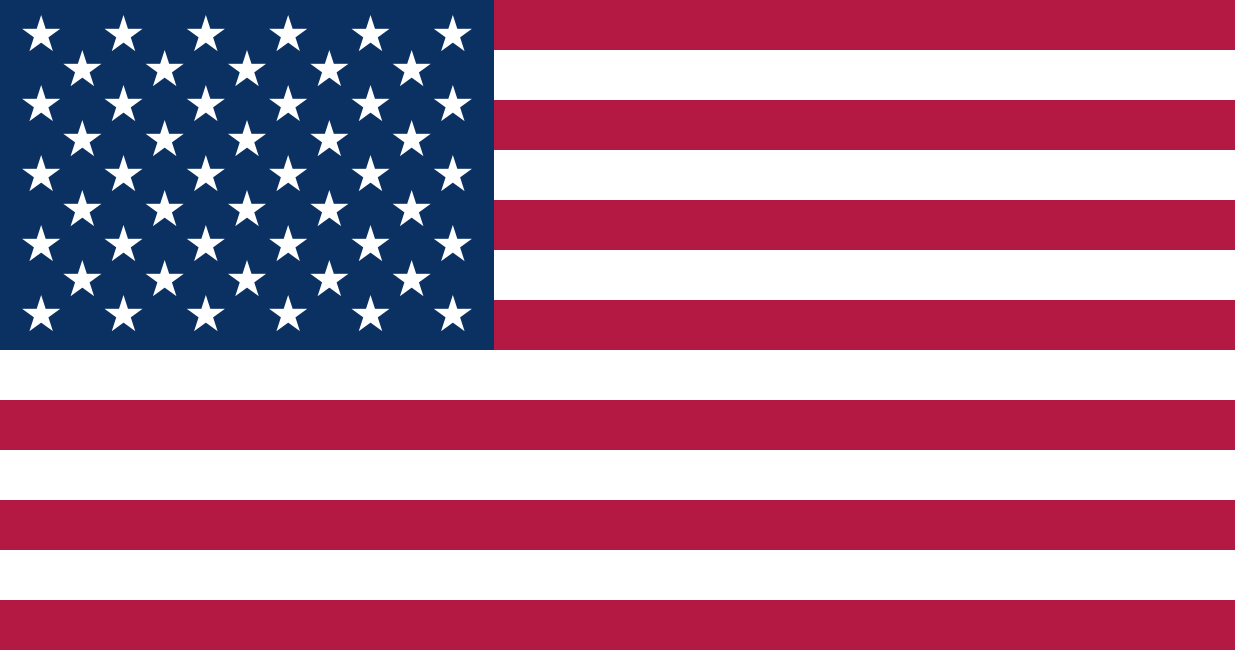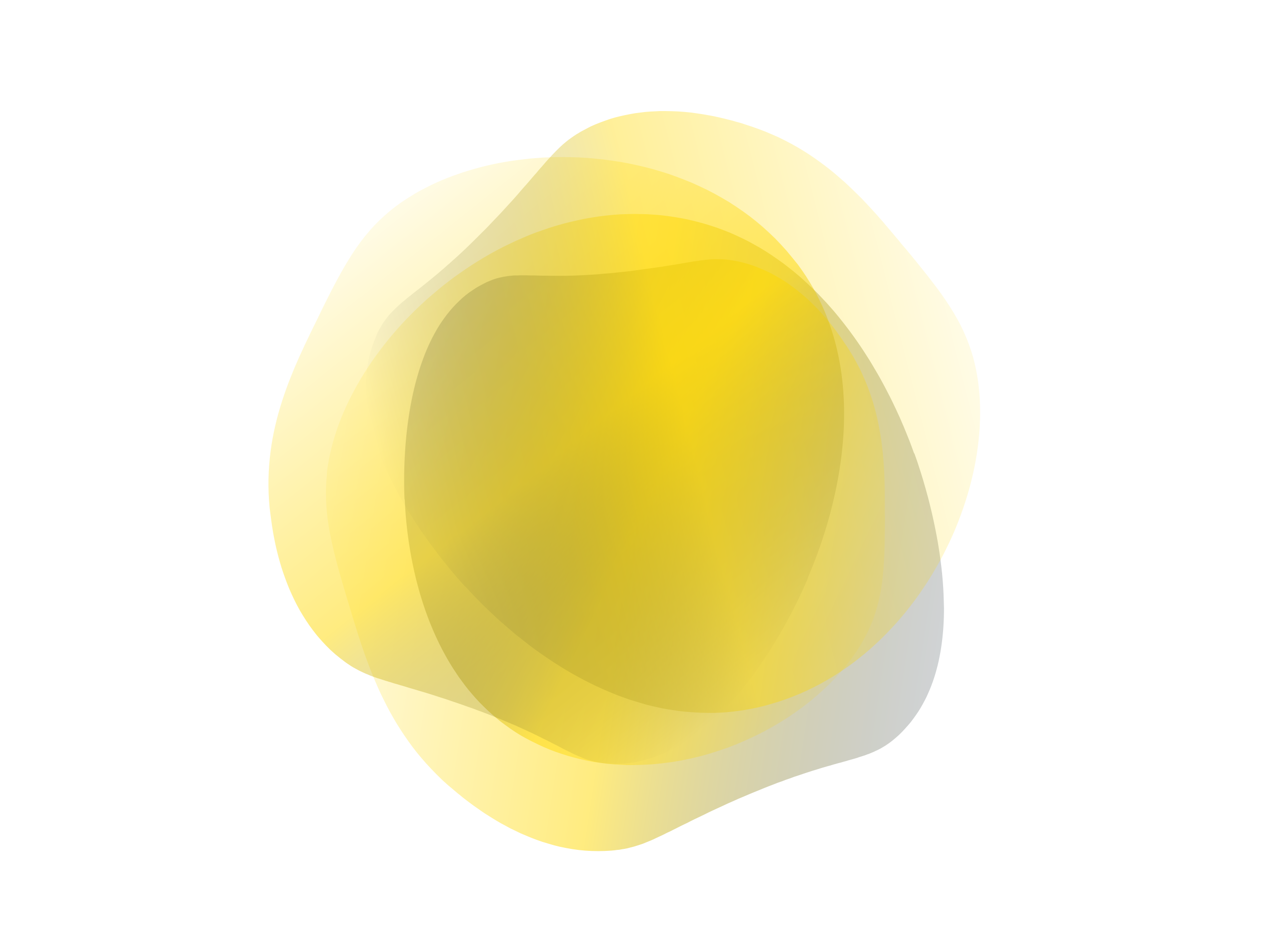"Ich weiß genau, was ich tun sollte, aber ich komme einfach nicht ins Handeln."
Dieser Satz begegnet mir in meiner Arbeit mit Klientinnen und Klienten immer wieder. Wir nennen es Prokrastination.
Doch was, wenn Aufschieben kein Mangel an Disziplin ist, sondern ein Hinweis auf eine innere Spannung?
Was, wenn dein Körper versucht, dir etwas Wichtiges mitzuteilen?
Prokrastination ist keine Störung des Willens, sondern eine Störung der Beziehung zu dir selbst.
In diesem Artikel zeige ich dir, warum das Aufschieben oft ein Schutzmechanismus ist und wie du durch Bewusstheit und Selbstzuwendung wieder in Kontakt mit deinem authentischen Handeln kommst. Ganz ohne Druck.
Prokrastination braucht Selbstabwertung
Hier ist eine unbequeme Wahrheit: Prokrastination existiert nur, wenn wir uns selbst verurteilen. Wenn wir glauben, wir hätten etwas längst erledigen müssen. Das eigentliche Problem ist also nicht das Nichtstun, sondern die Härte, mit der wir uns begegnen.
In meinen Coaching-Sessions sehe ich das häufig. Menschen, die viel leisten und Außergewöhnliches vollbringen, geraten genau dann ins Aufschieben, wenn eine Aufgabe emotional aufgeladen ist. Sie haben Angst zu scheitern oder nicht gut genug zu sein. Sie vermeiden nicht die Aufgabe, sondern das Gefühl, das damit verbunden ist.
Prokrastination ist emotionale Vermeidung. Sie ist das Abwenden vom inneren Unbehagen, von Scham, Druck, Angst oder Überforderung.
Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass diese Vermeidung zunächst gut ist. Unser Körper bringt uns in den Zustand der Prokrastination, um uns davor zu schützen, etwas zu tun, das uns emotional überfordert.
Deshalb frage ich meine Klientinnen und Klienten oft:
Könnte es sein, dass es gut ist, dass du diese Aufgabe nicht erledigt hast? Vielleicht versucht dein Körper, dich davor zu schützen, etwas zu tun, das gar nicht deinem Weg entspricht?
Prokrastination kann ein Ausdruck einer gestörten Zustimmung zum eigenen Leben sein.
Etwas in uns sagt Nein, während der Kopf Ja sagt. Diese Spannung ist kein Fehler, sondern ein Hinweis darauf, dass unser Handeln nicht im Einklang mit dem inneren Sinn steht.
Der Körper zieht die Handbremse, wenn der innere Wille fehlt oder übergangen wird. Erst wenn wir wieder Kontakt zu diesem inneren Ja finden, wird Handeln möglich.
Emotionale Vermeidung verstehen und verwandeln
Wenn wir uns dem Gefühl zuwenden, statt es zu vermeiden, verschwindet das Aufschieben oft von selbst. Ich arbeite hier gern mit der Frage:
Wie könnte ich das tun und mich dabei gut fühlen?
Das ist kein Trick, sondern ein Perspektivwechsel. Statt „Ich muss“ entsteht „Ich darf“. Wir holen die Aufgabe in den Bereich des Erlebens, nicht des Sollens.
Ein Beispiel aus meiner Praxis
Eine Klientin wollte monatelang ihr Website-Portfolio überarbeiten. Jedes Mal, wenn sie daran dachte, tauchte Druck auf. In der Sitzung haben wir die zugrunde liegende Angst erkannt: Die Angst, kein „perfektes“ Angebot zu erstellen.
Wir haben dann eine kleine Übung gemacht.
Erstell einen ersten Entwurf wie ein Kind. Kein Anspruch, kein Urteil, nur Spiel.
Nach einer Stunde hatte sie ihren Entwurf fertig und sagte:
„Ich habe gespielt. Ein Ergebnis mit Leichtigkeit."
Das ist die Energie, in der echtes Handeln entsteht. Nicht aus Zwang, sondern aus Verbindung.
Iteration statt Perfektion
Ein weiterer Schlüssel liegt in der veränderten Haltung. Der Übergang von „Ich muss es perfekt machen“ zu „Ich mache den ersten Entwurf und verbessere ihn schrittweise“.
Diese Haltung zeigt uns, dass Entwicklung kein Ziel, sondern ein Prozess ist. Wir sind nicht fertig, sondern im Werden.
Ich erinnere mich an meine ersten Podcast-Episoden. Sie waren bewusst alles andere als glatt. Aber genau darin lag der Lernprozess. Die Chance zum Start.
Wenn wir uns erlauben, Fehler als Feedback zu sehen, entsteht Leichtigkeit.
Mach den ersten Durchgang wie ein Dreijähriger und sei danach dein eigener Lektor.
Das iterative Prinzip löst Druck auf und macht Handeln wieder möglich. Es befreit uns vom Anspruch der Perfektion und öffnet den Raum für authentischen Ausdruck.
Urteil als Spiegel, nicht als Bedrohung
Ein weiterer Aspekt ist der Umgang mit Bewertung. Prokrastination entsteht oft aus der Angst, beurteilt zu werden. Viele Klientinnen und Klienten spüren eine innere Stimme, deren Urteil sie fürchten.
Doch was, wenn wir lernen, Kritik als Resonanz zu verstehen?
Jedes Urteil spiegelt eine Begegnung. Wenn mich etwas triggert, liegt darin die Chance, mich selbst besser zu verstehen.
Wenn ich durch Urteile getriggert werde, ist das Freiheit, denn ich weiß, dass ich daraus etwas lernen kann.
Ich lade Menschen oft ein, sich genau das bewusst zu machen. Bewertung ist kein Angriff, sondern Information. Häufig zeigt sich dann, dass das Urteil, vor dem wir Angst haben, eine Vorstellung ist, die im Nebel liegt.
Sobald wir uns ihr zuwenden und sie in Beziehung bringen, verliert sie ihre Bedrohung.
Priorität statt Selbstmissbrauch
Viele verwechseln Prokrastination mit schlechter Zeitplanung und suchen nach mentalen Tricks. Dabei übersehen sie, dass kein Mensch ein reiner Aufschieber ist. Die meisten sind hoch produktiv, nur nicht bei allem.
Das Aufschieben zeigt, dass die Priorität selbst nicht stimmig ist.
Wenn wir aufhören, uns dafür zu verurteilen, können wir wieder hören, was wirklich dran ist.
„Als ich aufhörte, mich selbst fertigzumachen, gab es einfach keine Prokrastination mehr."
Manchmal will ein Teil von uns gar nicht die Aufgabe erledigen, sondern zuerst etwas anderes verstehen oder ordnen. Gerade bei Führungskräften sehe ich das oft. Sie tun alles, was sie können, und verschieben genau das, was sie lernen müssten.
Nicht, weil sie faul sind, sondern weil sie an der Schwelle des Unbekannten stehen. Und das ist anstrengend.
Frühe Entfremdung vom Selbstvertrauen
Viele Menschen haben in ihrer Kindheit gelernt, dass ihre Impulse falsch sind. In der Schule oder Familie wurde vermittelt:
„Was du willst, zählt nicht. Mach, was man von dir erwartet, sonst droht Liebesentzug."
Diese Stimmen leben fort als innerer Kritiker. Man kann hier von einer gestörten Beziehung zum eigenen Wollen sprechen.
Die Lösung liegt nicht in Selbstdisziplin, sondern in Selbstzuwendung.
„Die Lösung für das Aufschieben ist, tief in sich hineinzuhören und nicht auf den inneren Kritiker, sondern auf das, was einem ein gutes Gefühl gibt."
Wenn wir wieder lernen, auf unsere Bedürfnisse und Rhythmen zu hören, endet Prokrastination von selbst. Es ist ein Prozess der Rückverbindung mit uns selbst.
Vier Prinzipien gegen Prokrastination
Hier sind vier praktische Prinzipien, mit denen du Prokrastination verwandeln kannst:
1. Emotion erkennen
Prokrastination zeigt ein vermiedenes Gefühl. Statt die Aufgabe zu bekämpfen, wende dich dem Gefühl zu.
Beispiel: Spüre die Angst vor Bewertung, statt sie zu vermeiden.
2. Iterativ handeln
Erlaub dir den ersten Entwurf. Perfektion kommt durch Überarbeitung, nicht beim ersten Versuch.
Beispiel: Schreibe ohne Zensur, überarbeite danach. Mach den ersten Durchgang wie ein Dreijähriger.
3. Kritik integrieren
Nutze Urteil als Spiegel. Jedes Feedback ist Resonanz, keine Gefahr.
Beispiel: Frage dich: Was zeigt mir diese Kritik über meine eigenen Themen?
4. Selbstbezug stärken
Lerne wieder, auf dich zu hören. Deine innere Stimme weiß, was stimmig ist.
Beispiel: Frage dich regelmäßig: „Was fühlt sich jetzt gerade richtig an?“
Fazit: Vom Aufschieben zum In-Kontakt-Sein
Prokrastination ist ein Lehrer. Sie zeigt uns, wo wir uns selbst verlieren, in Bewertung, Angst oder Kontrolle. Wenn wir uns diesen Gefühlen zuwenden, entsteht Präsenz – eine Präsenz mit uns selbst.
Dann geht es nicht mehr darum, was wir tun, sondern aus welcher Haltung heraus.
Alles zu seiner Zeit. Denn wenn der richtige Moment gekommen ist, entwickeln sich die Dinge ganz natürlich.
Prokrastination ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist eine Einladung zur Selbstbegegnung. Wenn wir die innere Härte loslassen, wird Handeln nicht mehr zur Pflicht, sondern zum Ausdruck von Verbundenheit mit uns selbst und mit dem, was wirklich zählt.
Raus aus dem Kopf, rein ins Gefühl.
Dein nächster Schritt
Wenn du spürst, dass Aufschieben in Wahrheit ein Ruf nach Verbindung ist, begleite ich dich gern dabei, diesen Ruf zu verstehen und in Handlung zu bringen.
FAQs
Ist Prokrastination eine psychische Störung?
Prokrastination ist keine eigenständige psychische Störung und wird nicht als Diagnose nach ICD-10 geführt. Sie kann jedoch ein Symptom verschiedener psychischer Belastungen sein oder mit Zuständen wie Depression, Angststörungen oder ADHS einhergehen. In den meisten Fällen ist Prokrastination ein Verhaltensmuster, das auf emotionale Vermeidung hinweist, nicht auf eine Krankheit.
Was steckt hinter Prokrastination?
Hinter Prokrastination steckt meist emotionale Vermeidung. Wir schieben Aufgaben auf, weil sie mit unangenehmen Gefühlen wie Angst vor Versagen, Scham, Überforderung oder Unsicherheit verbunden sind. Oft liegt auch eine frühe Entfremdung vom eigenen Selbstvertrauen zugrunde, wenn wir in der Kindheit gelernt haben, dass unsere Impulse und Bedürfnisse nicht zählen.
Ist Prokrastination ein Symptom von ADHS?
Prokrastination kann ein Symptom von ADHS sein, ist aber nicht ausschließlich damit verbunden. Menschen mit ADHS haben oft Schwierigkeiten mit der Handlungsplanung und Impulskontrolle. Allerdings erleben auch viele Menschen ohne ADHS Prokrastination, insbesondere bei emotional aufgeladenen oder angstbesetzten Aufgaben.
Wie überwinde ich Prokrastination?
Prokrastination überwindest du nicht durch mehr Disziplin, sondern durch Selbstzuwendung. Frage dich: „Welches Gefühl vermeide ich gerade?“ und „Wie könnte ich diese Aufgabe tun und mich dabei gut fühlen?“ Arbeite mit dem Prinzip der Iteration statt Perfektion, erlaube dir den ersten Entwurf wie ein Kind zu machen, und höre wieder auf deine inneren Bedürfnisse statt nur auf den inneren Kritiker.
Was ist der Unterschied zwischen Faulheit und Prokrastination?
Faulheit ist ein wertendes Urteil, Prokrastination hingegen ist emotionale Vermeidung. Bei Prokrastination wollen wir die Aufgabe eigentlich erledigen, vermeiden aber das damit verbundene unangenehme Gefühl. Menschen, die prokrastinieren, sind oft in anderen Bereichen sehr produktiv. Das zeigt, dass es nicht um mangelnde Motivation geht, sondern um eine emotionale Blockade bei bestimmten Aufgaben.
Welche Therapieform hilft bei Prokrastination?
Kognitive Verhaltenstherapie kann hilfreich sein, besonders wenn sie emotionale Muster und Selbstabwertung adressiert. Auch achtsamkeitsbasierte Ansätze, die den Fokus auf Selbstmitgefühl und emotionale Regulation legen, zeigen gute Erfolge. Im Coaching arbeite ich mit Ansätzen, die die Beziehung zu sich selbst stärken und helfen, vermiedene Gefühle bewusst zu integrieren.
Was passiert im Gehirn bei Prokrastination?
Bei Prokrastination aktiviert unser Gehirn Vermeidungsstrategien, um uns vor emotional belastenden Situationen zu schützen. Der präfrontale Kortex, zuständig für Planung und Entscheidungen, wird durch emotionale Zentren wie die Amygdala gehemmt. Das limbische System signalisiert Gefahr, und wir suchen nach kurzfristiger Erleichterung statt langfristiger Zielverfolgung.
Welche Ursachen kann Prokrastination in der Kindheit haben?
Viele Menschen haben in ihrer Kindheit gelernt, dass ihre eigenen Impulse und Bedürfnisse falsch sind. Aussagen wie „Was du willst, zählt nicht“ oder die Erfahrung von Liebesentzug bei Fehlern führen zu einem gestörten Selbstbezug. Der innere Kritiker entsteht aus diesen frühen Prägungen und macht es schwer, auf die eigene innere Stimme zu vertrauen.
Was ist das Gegenteil von Prokrastination?
Das Gegenteil von Prokrastination ist nicht Produktivität oder Disziplin, sondern authentisches Handeln aus innerer Zustimmung. Es ist der Zustand, in dem wir im Einklang mit uns selbst agieren, ohne inneren Widerstand. Wenn wir aus diesem Zustand heraus handeln, entsteht keine Spannung zwischen Wollen und Sollen.
Quellen
Photo by Vitaly Gariev on Unsplash